| San Francesco di Paola |
| Freundschaftliche Beziehungen zwischen Fellbach und Cariati |
| Migration Kirche Spiritualität |
____________________________________________________________________
Vito Antonio Lupo
Die Italienischen Katholischen Gemeinden in Deutschland
Ein
Beispiel für die Auswanderungspastoral
während der letzten 50 Jahre
_____________________________________________________________________
Lit
Verlag Verlag für wissenschaftliche Literatur, Münster-Hamburg-Berlin-Wien-London
Reihe Fremde
Nähe - Beiträge zur interkulturellen Diskussion Bd. 22, 2005,
632 S.,
49,90 EUR, gb., ISBN 3-8256-8395-7
www.lit-verlag.de/cgi-local/suchbuch
BESPRECHUNG
Don
Elios Contini entwirft einen Comic-Sprachkurs.
Padre Sandro eröffnet im Jahr 1968 eine Ganztagesbetreuung für
italienische Kinder. Eine Frau die aus den Abbruzzen stammt, begründet
1979 in Greven die
„lebendige Krippe“.
Das sind nur drei Beispiele für die Kreativität und Schaffenskraft, aber auch für die Opferbereitschaft italienischer Priester und ihrer MitarbeiterInnen in rund 50 Jahren italienischsprachiger Seelsorge in Deutschland.
Während der letzten 50 Jahre wurden in Deutschland etwa drei Millionen italienische Mitbürger bzw. Katholiken von mehr als 450 Geistlichen, vielen Ordensschwestern und Laienmitarbeitern in 103 Gemeinden seelsorgerlich betreut.(S.500) Doch nach einem halben Jahrhundert steht die italienische Seelsorge in Deutschland vor einer Zäsur: Die Zeit der Missionen geht zu Ende, die soziale und kirchliche Integration schreitet fort, so dass die Aufgaben muttersprachlicher Gemeinden neu definiert werden müssen.
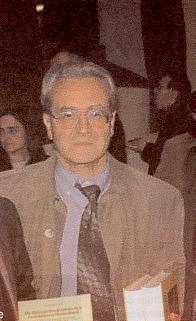
Diese
Zäsur ist der Moment, in dem Don Vito Lupo, italienischer
Seelsorger in der Italienischen Katholischen Gemeinde Limburg-Wetzlar,
die vergangenen 50 Jahre dokumentiert und analisiert, nicht zuletzt auch,
um Informationen aus dieser Zeit zu sichern, bevor sie verloren gehen.
Don Vito Lupo will mit seinem Werk veranschaulichen, dass die Seelsorge
der vergangenen Jahrzehnte in den italienischen katholischen Missionen
eine kreative und angemessene Antwort war und ist auf die große
Herausforderung, welche die Migration der Italiener nach Deutschland darstellte.
Die Geschichte der
ital. Einwanderung
In einem geschichtlichen Abriss erzählt Don Vito Lupo von der italienischen
Einwanderung nach Deutschland seit dem 18. Jahrhundert.
Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert verständigten sich Lorenz
Werthmann, Gründer des Deutschen Caritasverbandes, mit Bischof
Geremia Bonomelli von Cremona, einem der in Sachen Emigration besonders
engagierten Bischöfe Italiens, und dem Gründer des St. Raphaelsvereins
für Auswanderer, Peter Paul Cahensly, auf Grundlinien für
die Seelsorge an italienischen Migranten in Deutschland, die sich teils
bis heute durchziehen. Dazu gehört beispielsweise die Kooperation
von Seelsorge und Caritas. Die erste Mission wird 1896 in Konstanz
gegründet.
Um 1904 gab es immerhin 104204 Italiener in Deutschland.
Vom „Gastarbeiter“
zum „Italienischen Mitchristen“
Doch die große Herausforderung kommt erst Mitte der 50er Jahre des
20. Jahrhunderts.
Rund 100 000 Italiener, vor allem Männer, machen sich zwischen 1955
und 1960 auf den Weg nach Deutschland; 1973 sind es bereits 450 000; heute
hat sich die Zahl bei etwa 630 000 stabilisiert. Vor allem aus Süditaliens
Regionen (Kampanien, Abbruzzen und Molise, Apulien, Basilikata, Kalabrien,
Sardinien, Sizilien) kam die überwiegende Mehrzahl der Emigranten.
Das hatte geschichtliche, soziale, wirtschaftliche und politische Gründe,
wie Don Vito ausführlich beschreibt
(S. 50 – 72).
Die italienische und die deutsche Kirche trifft diese Zuwanderung nicht unvorbereitet. Von Anfang an wird diese Wanderungsbewegung seelsorgerlich begleitet. Bald entwickeln sich tragfähige Strukturen: Im Zusammenspiel von deutschen und italienischen Diözesen, von Ordensgemeinschaften und einzelnen Missionen koordiniert der Nationaldirektor, später: Delegat, den Aufbau der Gemeinden und den Einsatz von Priestern und Ordensschwestern (S. 95 – 99). Auch die Gründung der Zeitschriften La Squilla und später (1963) Corriere d’Italia ist eine Antwort auf die Notwendigkeit, der neuen Situation Strukturen zu geben (S. 100ff).
"Während
den 35 Jahren meines Aufenthalts in Deutschland habe ich erlebt, wie Tag
für Tag, zusammen mit anderen Mitbrüdern, etwas aufgebaut wurde,
was es so zuvor nicht gab: Eine Seelsorge für die Migranten. Dieses
Massenphänomen Emigration war in Italien genausowenig verstanden
worden wie in Deutschland. Es handelte sich um hunderttausende Personen,
die von Italien weggingen, vor allem aus dem Süden, und keiner sprach
davon. Ich erinnere mich, dass ich nach Deutschland kam, um Ferien zu
machen. Als ich dann die große Dringlichkeit sah, entschied ich
mich zu bleiben und war u.a. als Arbeiter in Neuss tätig. Für
jeden von uns Priestern war die Emigration eine große Erfahrung."
...
"Die Sprache der Pastoral musste sich notwendigerweise an die eingewanderten
Arbeiter anpassen, und das ist uns gelungen."
...
"Es gibt heute auch viele deutsche Seelsorger, die beginnen, die
Volksreligiosität zu begreifen und neu zu schätzen."
(Autor don Vito Lupo, befragt von Mauro Montanari in CORRIERE D'ITALIA, Januar 2006, S. 13)
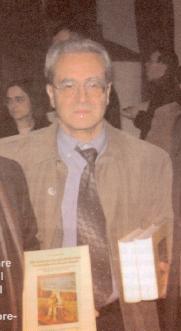
(Quelle: Corriere d'Italia, Januar 2006)
Jährlich finden Nationaltagungen der italienischen Seelsorger statt. Die Themen dieser Tagungen spiegeln die jeweiligen Schwerpunkte und Nöte der Seelsorge in den Missionen, behandeln aber auch grundsätzliche Fragen von Emigration und Kirche (S. 519 – 524).
Nun folgt – quasi als Hauptteil des Buches - die ausführliche Dokumentation der italienischsprachigen Seelsorge der letzten 50 Jahre, wie sie sich in den 103 Missionen konkretisiert, die über ganz (West-) Deutschland sowie Berlin verteilt sind, illustriert mit 171 s/w-Fotos. Nach Bistümern geordnet wird die Geschichte einer jeden einzelnen Missione erzählt und dokumentiert. Dabei versteht es Don Vito, die Besonderheiten einer Gemeinde hervorzuheben. Er beleuchtet aber auch kritisch, warum sich manche Missionen sehr zum Positiven entwickelt und andere weniger erfolgreich gewirkt haben; dabei nimmt er durchaus Rücksicht auf die häufig noch lebenden Akteure.
Drei Phasen lassen sich für diese fünfzig Jahre Seelsorgsgeschichte
herausfiltern, wie Padre Gabriele Parolin, Delegat in den Jahren
1998 - 2005, in seinem Vorwort aufzeigt:
In der ersten Phase kommen vor allem Männer, die seelsorgerlich und
sozial betreut sein wollen.
In der zweiten Phase kommen Familien, die soziale Hilfen benötigen
und vielfach erhalten.
Die dritte Phase, in der wir uns befinden, bringt eine starke Vernetzung
mit der örtlichen Pastoral.
Feuerwehrpastoral
Die Zeit der Feuerwehrpastoral sieht die italienischen Priester
an der Seite ihrer Landsleute nach Deutschland kommen. Vielfach beschreibt
Vito Lupo, wie sich die italienischen Priester nicht hinter Institutionen
und Mauern verstecken, sondern ihre Herde dort aufsuchen, wo sie sich
befindet:
In den Fabriken, in den Baracken, auf den Baustellen – immer nahe
bei den Menschen.
Familien kommen
Erst mit der verstärkten Ankunft von Familien wurden Gemeindestrukturen
und eigene Räume zunehmend wichtiger. Im Vordergrund stand vielfach
die soziale Herausforderung.
Angesichts der vielfachen Notwendigkeit, dass beide Eltern einer Berufstätigkeit
nachgehen, wurde die Betreuung und Förderung der Kinder zu einer
zentralen Aufgabe. Besonders hervorzuheben ist die Errichtung der Doposcuola in Saarbrücken (ab 1969, S. 267), wo italienische Kinder betreut
und gefördert werden konnten. Die Doposcuola bildete eine Bündelung
der Kräfte von Land, Kirche, Konsulat, Eltern und Kommunen; eine
Kooperation, die im Gegensatz steht zu vielen verzettelten Einzelaktionen
zur Förderung der Bildungschancen von Migrantenkindern an anderen
Orten.
Von 1963 – 1981 führten Ordensschwestern in Essen einen Kindergarten.
Padre Alessandro Rossi gründete in Fellbach im Jahr 1968
eine Kindertagesstätte.
Bemerkenswert sind auch die Gründung einer Selbsthilfegruppe
italienischer Querschnittsgelähmter in Heidelberg (S. 281) und
die Betreuungskontakte einer italienischen Gemeinde in Schwäbisch-Gmünd
zur Behinderteneinrichtung Haus Lindenhof über viele Jahre (S. 320).
Sehr wichtig war auch die Präsenz italienischer Priester in Gefängnissen
und Krankenhäusern. Einzelne Ansätze zur Präsenz in Schulen
gab es durchaus, zumindest im italienisch-muttersprachlichen Unterricht.
Insgesamt muss aber gesagt werden, dass die deutsche Schule und auch ihr
Religionsunterricht der Mehrzahl der italienischen Seelsorger eher fremd
geblieben ist.
Im Zusammenhang mit
der komplexen Situation der Ital. Mission in Berlin (allein 6000 in der
Gastronomie Beschäftigte) kommt zur Sprache, dass im Spannungsfeld
der Migration viele italienische Katholiken sich anderen religiösen
Gruppen zugewandt haben: Adventisten, Freikirchen, Zeugen Jehovas. Durch
konfessionsverbindende Ehen zwischen italienischen Katholiken und Partnern
anderer Konfession wird die Ökumene zunehmend ein wichtiges Thema.
Auch die immer häufiger vorkommenden bikulturellen und bireligiösen
Eheschließungen stellen die Pastoral vor neue Herausforderungen.
Don Vito Lupo weist immer wieder darauf hin, dass eine erfolgreiche Seelsorgsarbeit
meist mit einer guten Zusammenarbeit zwischen den Priestern und den Sozialbetreuern
der Caritas verknüpft war. In vielen Fällen arbeiteten die Missionen
nach einem zuvor erstellten pastoralen Konzept. In manchen Regionen konnte
im Lauf der Zeit die muttersprachliche Seelsorge zurückgefahren werden,
weil die italienischen Katholiken sich teilweise oder ganz in die örtlichen
Kirchengemeinden eingebunden haben, was z.B. die Vorbereitung der Erstkommunion
betrifft (Göttingen S. 123).
Bei seiner Beschreibung italienischer Gemeinden spart Don Vito Lupo auch Kuriositäten nicht aus: Ein sizilianischer Arbeiter in Beckum/Dortmund gab sich fünf Jahre lang erfolgreich als "Padre Angelo" aus, zelebrierte Messen, taufte, nahm die Beichte ab, leitete ein Altenheim und eine Klinik. (S. 159)
Analysen
Im Anschluss an die Dokumentation der geschichtlichen Entwicklung der
insgesamt 103 Missionen in Deutschland geht Don Vito Lupo auch systematisch
analysierend an die italienische Seelsorge in Deutschland heran.
Da die nach Deutschland emigrierten Italiener in den vergangenen 50 Jahren mehrheitlich aus Süditalien zugewandert sind, untersucht Don Vito Lupo die Eigenart der süditalienischen Religiosität (S. 447).
Schließlich analysiert er die wichtigsten pastoralen Bereiche der Auswanderungsseelsorge für die pastorale Praxis und deutet Perspektiven für die Zukunft an.
Perspektiven
Für die Zukunft der muttersprachlichen Pastoral wertet Don Vito Lupo
die Bildung muttersprachlicher Gemeinden im Verbund einer Seelsorgeeinheit als „wegweisend“ (S. 317), wenn er auch einschränkt,
dass die daraus gewonnen Erfahrungen noch nicht abschließend ausgewertet
werden können.
Für ebenfalls wegweisend hält der Autor die pastorale Lösung
für Essen und Umgebung: Dort gibt es eine Seelsorgestelle
mit drei Geistlichen, welche die andern Schwerpunktfilialen im Umland
wöchentlich seelsorgerlich betreuen. (S. 151)
Realistisch für die Zukunft erscheint das Modell Hanau aus
dem Jahr 1995, als absehbar war, dass kein italienischer Priester mehr
ausschließlich für Hanau zur Verfügung stehen würde:
Durch weitgehende Kooperation mit den örtlichen Gemeinden und der
Erledigung allgemeiner pastoraler Aufgaben durch einen Pastoralreferenten
entstand eine praktikable muttersprachliche Seelsorge. (S. 199).
In Wiesbaden wurden schon im Jahr 1978 die Weichen Richtung Zukunft
gestellt durch eine enge Partnerschaft zwischen der Pfarrei Maria Hilf
und der italienischen Seelsorge. Die dabei erarbeiteten Leitlinien besitzen
hohe Aktualität und können Vorbild für neue Lösungen
sein. (S. 222-223)
Was noch zu tun ist
Selbst eine so umfangreiche Arbeit kann nicht alle Aspekte des Themas
abdecken. Es bleiben einige wenige Lücken, die auf eine zukünftige
Bearbeitung und Forschung warten.
Ein wichtiges Ziel der vorliegenden Arbeit war auch, die – vor allem
italienischen – Priester zu würdigen, die mit hohem Einsatz
von Kraft, Gesundheit und Phantasie die Seelsorge an den italienischen
Katholiken geleistet und vorangetrieben haben. Damit nimmt Don Vito aber
auch in Kauf, dass die Leistungen der Schwestern (und damit: der Frauen)
in nur sehr geringem Maß auftauchen; auch die Leistungen einzelner
Migranten oder ganzer Gruppen und Gemeinden kommen kaum zur Sprache. Ein
Priester, der nur wenige Wochen Vertretung in einer Mission gemacht hat,
wird namentlich genannt, während die oft jahrelange und konzeptionell
herausragende pastorale Arbeit einer Ordensschwester nicht auftaucht.
Versteht man Inkulturation als einen wechselseitigen Lernprozess, so wäre interessant zu prüfen, was die deutsche Kirche von den Erfahrungen der Missionen und ihrer muttersprachlichen Seelsorge lernen kann. Die Missionen waren ja nicht zuletzt auch Orte, wo Konzeptionen von Pastoral entworfen und praktiziert wurden, auch im Austausch mit pastoraler Theorie und Praxis italienischer Herkunft, mit manchen Fassetten, die für die deutsche Pastoral (und Pastoraltheologie) Impulse geben könnten.
Neue Herausforderungen
Es ist Don Vito’s Verdienst, mit der vorliegenden Arbeit eine erste
umfassende Dokumentation geschafft zu haben. Einfache Antworten wird es
auch in Zukunft nicht geben. Bei ca 30 000 neu zugewanderten Italienern
jährlich gibt es auch weiterhin eine erste Generation, die
auf geeignete Weise in ihrer Muttersprache angesprochen werden will. Jede
muttersprachliche Gemeinde steht schon heute vor der Herausforderung,
Personen und Familien zu vereinen, die ganz unterschiedliche Grade an
Integration bzw. Inkulturation aufweisen.
Nach wie vor ist die Frage der sozialen Integration der ausländischen
Kinder nicht gelöst, wie Pisa eindrücklich nachgewiesen
hat. Unter den italienischen Immigranten ist die Arbeitslosigkeit vergleichsweise deutlich höher.
Deshalb ist es verfrüht zu glauben, die Integration der italienischen
Katholiken sei insgesamt vollzogen, davon abgesehen, dass eine vollkommene
Angleichung im Sinne einer fruchtbaren Vielfalt nicht wünschenswert
sein kann. Neu ist aber, dass die Verantwortung für die muttersprachliche
Seelsorge - sei es deutsche, italienische oder anderssprachige - bei allen
liegt, und das ist ein großer Fortschritt.
(Thomas Raiser)